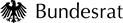In der komplizierten politischen und wirtschaftlichen Gemengelage nach dem Zweiten Weltkrieg beschließen die Westalliierten, zumindest in ihren Gebieten eine einheitliche staatliche Ordnung anzustreben. Am 1. Juli 1948 ermächtigen sie die elf westdeutschen Ministerpräsidenten, binnen zwei Monaten eine verfassungsgebende Versammlung einzuberufen. Deren Aufgabe soll darin bestehen, eine Verfassung nach dem Leitbild einer föderalen demokratisch-parlamentarischen Ordnung zu erarbeiten.
Keine Verfassung, sondern Grundgesetz
Begleitet von vielen Diskussionen beginnen die Vorbereitungen. Die Ministerpräsidenten der westdeutschen Länder treffen sich Anfang Juli 1948 auf dem Rittersturz, einem Aussichtpunkt bei Koblenz, und beraten über die Konsequenzen des Auftrags.
Sie sehen die Gefahr, dass mit Einführung einer Verfassung in den westlichen Ländern die Teilung Deutschlands vertieft und die Einheit des Landes gefährdet wird. Um dem zu begegnen, beschließen sie, statt der verfassungsgebenden Versammlung einen Parlamentarischen Rat einzuberufen und keine Verfassung, sondern höchstens ein Organisationsstatut oder ein Grundgesetz zu verabschieden.

Konstituierung des Parlamentarischen Rates vor 75 Jahren
© REGIERUNGonline | Munker
Eröffnet wird der Parlamentarische Rat am 1. September 1948 mit einem Festakt im Bonner Naturkundemuseum Koenig. Zuvor hatten die elf westdeutschen Landtage 61 Männer und vier Frauen als Mitglieder bestimmt. Hinzu kamen fünf nicht stimmberechtigte Mitglieder aus Berlin.
Gleich im Anschluss an die Eröffnung nimmt der Rat seine Arbeit in der Aula der ehemaligen Pädagogischen Akademie auf - dem späteren Plenarsaal des Bundesrates in Bonn. Zum Präsident des Parlamentarischen Rates wird Konrad Adenauer, früherer langjähriger Kölner Oberbürgermeister und Vorsitzender des Preußischen Staatsrates, gewählt.
Harte Auseinandersetzungen

Konstituierung des Parlamentarischen Rates vor 75 Jahren
© REGIERUNGonline | Hubmann
Man ist sich im Rat einig, dass sich die Fehler von Weimar, die zum Scheitern der demokratischen Grundordnung führten, nicht wiederholen dürfen. Konsens besteht auch in dem Vorhaben, die Grundrechte im Verfassungsgefüge zu verankern. Debatten zu anderen Themen, wie die Bund-Länder-Beziehungen und die Verteilung der Staatsfinanzen, verlaufen jedoch äußerst kontrovers und sind belastet von den parteipolitischen Erwägungen der Mitglieder.
Erschwerend wirken darüber hinaus die Eingriffe der Alliierten. Sämtliche Beratungsergebnisse müssen von den Militärgouverneuren der Westmächte abgesegnet werden.
Bundesrat oder Senat
Besonders die Funktion und Zusammensetzung einer zweiten Kammer neben dem Bundestag sorgt für Streit. Die Verfechter einer Bundesratslösung machen sich stark für eine echte "zweite Kammer". Sie soll aus Mitgliedern der Landesregierungen bestehen und in ihren Rechten dem Bundestag gleichgestellt sein.
Gegner einer Bundesratslösung bemängeln unter anderem die unzureichende politische Legitimation der Bundesratsmitglieder. Alternativ schlagen sie eine Senatslösung für die zweite Kammer vor. Die Senatoren sollen anders als in einem Bundesrat nicht weisungsgebunden sein und entweder vom Volk oder den Landtagen gewählt werden.
Kompromiss: Bundesrat mit eingeschränkten Rechten
Im Streit um die Art und die Kompetenzen der zweiten Kammer finden schließlich der bayerische Ministerpräsident Hans Ehard (CSU) und der Innenminister von Nordrhein-Westfalen, Walter Menzel (SPD), außerhalb des Parlamentarischen Rates einen Kompromiss. Die dabei ausgehandelte "abgeschwächte Bundesratslösung" sieht einen Bundesrat vor, der sich aus Mitgliedern der Landesregierungen zusammensetzt und nur bei bestimmten Materien mit Länderbezug dem Bundestag gleichberechtigt ist.
Noch heftiger und ausdauernder als um die Ausgestaltung der zweiten Kammer wird im Parlamentarischen Rat über die Finanzen gestritten. Dabei geht es um die Verteilung der Kompetenzen in der Finanzgesetzgebung und Finanzverwaltung und um die Verteilung des Steueraufkommens zwischen Bund und Ländern. Um die Beratungen nicht endlos fortzusetzen, drängen schließlich die alliierten Militärgouverneure und die Regierungschefs der Länder auf ein Kompromiss.
Große Mehrheiten für Annahme

Konstituierung des Parlamentarischen Rates vor 75 Jahren
© REGIERUNGonline | Hubmann
Fast neun Monate nach seiner Einsetzung liegt dem Parlamentarischen Rat schließlich ein Grundgesetzentwurf zur Abstimmung vor. Am 8. Mai 1949 wird dieser mit 53 gegen zwölf Stimmen angenommen. Der Grundgesetzentwurf wird anschließend von den Landtagen ratifiziert. Eine Ausnahme macht der Bayerische Landtag. Dort steht der Grundgesetzentwurf wegen zu wenig föderaler Elemente in der Kritik. Um ein Scheitern zu vermeiden, entscheidet der Landtag, dass das Grundgesetz auch in Bayern bindend sei, sofern das Grundgesetz in zwei Dritteln der deutschen Länder angenommen wird.
In der zwölften und letzten Sitzung des Parlamentarischen Rates am 23. Mai 1949 wird das Grundgesetz feierlich verkündet und tritt mit Ablauf desselben Tages in Kraft.
Feierstunde zum 75. Jahrestag
In einer Feierstunde würdigt der Deutsche Bundestag am 1. September 2023 im Museum Koenig in Bonn die Konstituierung des Parlamentarischen Rates vor 75 Jahren. Zu den geladenen Gästen zählen u.a. Bundesratspräsident Peter Tschentscher und weitere Repräsentanten der Verfassungsorgane. Nach einleitenden Worten von Bundestagspräsidentin Bärbel Bas hält Bundespräsident a.D. Joachim Gauck die Festrede.