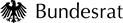Zu Beginn der Gedenkveranstaltung verwies Bundestagspräsident Nobert Lammert auf die vielen Millionen Opfer des "beispiellosen Vernichtungsfeldzugs gegen andere Nationen und Völker, gegen Slawen, gegen die europäischen Juden". Der 8. Mai sei deshalb für den ganzen Kontinent ein Tag der Befreiung gewesen, aber kein Tag der deutschen Selbstbefreiung, unterstrich Lammert. Unsere Gedanken und unser Respekt gälten heute vor allem denen, die unter unvorstellbaren Verlusten die nationalsozialistische Terrorherrschaft beendet haben, sowohl in den Reihen der westlichen Alliierten als auch auf Seiten der Roten Armee, sagte der Bundestagspräsident.
Winkler: Unantastbarkeit der Würde jedes Menschen achten
Heinrich August Winkler erinnerte in seiner Gedenkrede an den Philosophen Ernst Cassirer, der Hitlers politische Karriere als „Triumph des Mythos über die Vernunft und diesen Triumph als Folge einer tiefen Krise“ gedeutet hatte. Dieser Mythos sei immer da und warte auf seine Gelegenheit. „Diese Stunde kommt, sobald die bindenden Kräfte im sozialen Leben der Menschen aus dem einen oder anderen Grunde ihre Kraft verlieren und nicht länger imstande sind, die dämonischen Kräfte zu bekämpfen“, zitierte der Historiker den 1945 im amerikanischen Exil verstorbenen Philosophen.
„Angesichts von Ausbrüchen der Fremdenfeindschaft, wie wir sie in Deutschland in den letzten Monaten erlebt haben, und von antisemitischer Hetze und Gewalt hier und in anderen europäischen Ländern sind die Worte Cassirers von geradezu beklemmender Aktualität“, sagte Winkler. Sie mahnten zu jeder Zeit, die eigentliche Lehre der deutschen Geschichte der Jahre 1933 bis 1945 zu beherzigen: die Verpflichtung, unter allen Umständen die Unantastbarkeit der Würde jedes einzelnen Menschen zu achten.
Die Deutschen von sich selbst befreit
Erst nach Jahrzehnten habe sich in Deutschland die Einsicht durchgesetzt, dass der Holocaust die „Zentraltatsache der deutschen Geschichte des 20. Jahrhunderts“ ist. Der Sieg der Alliierten über Deutschland habe die Deutschen von sich selbst befreit – im Sinne der Chance, sich von politischen Verblendungen und von Traditionen zu lösen, die Deutschland von den westlichen Demokratien trennten.
Den Ideen der amerikanischen Revolution von 1776 und der französischen Revolution von 1789 hätten sich „maßgebliche deutsche Eliten“ bis weit ins 20. Jahrhundert hinein verweigert. Erst die Erfahrung der deutschen Katastrophe der Jahre 1933 bis 1945, des Höhepunkts der deutschen Auflehnung gegen die politischen Ideen des Westens, habe diesem Ressentiment den Boden entzogen.
Erst allmählich sei es gelungen, so der Historiker, die immer noch einflussreichen nationalapologetischen Deutungen der deutschen Geschichte zu überwinden und der verbreiteten Neigung entgegenzuwirken, im deutschen Volk das erste Opfer Hitlers zu sehen und sich selbst von jeder Mitverantwortung für damals geschehenes Unrecht freizusprechen. „Aber wären sie nicht bereit gewesen, sich der einzigartigen Monstrosität des Holocausts, der Ermordung der Sinti und Roma, von Zehntausenden geistig behinderter Menschen sowie zahllosen Homosexuellen und der Verantwortung für schrecklichste Kriegsverbrechen in den von Deutschland besetzten und ausgebeuteten Ländern Europas zu stellen - wie hätte die Bundesrepublik Deutschland je wieder zu einem geachteten Mitglied der Völkergemeinschaft werden können?“
Deutschland habe seine Einheit 1990 nur wiedererlangt, weil es glaubwürdig mit jenen Teilen seiner politischen Tradition gebrochen hatte, die der Entwicklung einer freiheitlichen Demokratie westlicher Prägung entgegenstanden. Die deutsche Frage habe sich nur lösen lassen, wenn zugleich „ein anderes Jahrhundertproblem“, die polnische Frage, gelöst wurde. „Das eben geschah durch den Zwei-plus-Vier-Vertrag und den deutsch polnischen Grenzvertrag vom 14. November 1990: zwei Verträge, durch die die bestehende deutsch-polnische Grenze an Oder und Görlitzer Neiße für alle Zukunft in völkerrechtlich verbindlicher Form anerkannt wurde“, sagte Winkler.
Kein Schlussstrich unter eine solche Geschichte
Abgeschlossen sei die deutsche Auseinandersetzung mit der eigenen Vergangenheit nicht, und sie werde es auch niemals sein. Jede Generation werde ihren Zugang zum Verständnis einer so widerspruchsvollen Geschichte wie der deutschen suchen. Die Aneignung dieser Geschichte muss nach Ansicht Winklers die Bereitschaft einschließen, sich den dunklen Seiten der Vergangenheit zu stellen. „Niemand erwartet von den Nachgeborenen, dass sie sich schuldig fühlen angesichts von Taten, die lange vor ihrer Geburt von Deutschen im Namen Deutschland begangen wurden.“ Zur Verantwortung für das eigene Land gehöre aber immer auch der Wille, sich der Geschichte des Landes im Ganzen zu stellen. Das gelte für alle Deutschen und für die, die sich entschlossen haben oder noch entschließen werden, Deutsche zu werden.
Es gebe keine moralische Rechtfertigung dafür, die Erinnerung an Verbrechen von SS und Wehrmacht wie die Belagerung und Aushungerung von Leningrad, den in Kauf genommenen Tod der Hälfte von insgesamt 5,7 Millionen sowjetischen Kriegsgefangenen, die Vernichtung des jüdischen Ghettos in Warschau und die systematische Zerstörung der polnischen Hauptstadt 1944 nicht wachzuhalten und die moralischen Verpflichtungen zu vergessen, die sich daraus ergeben. Dasselbe gelte für die unmenschliche Behandlung von Millionen von Zwangsarbeitern: „Unter eine solche Geschichte lässt sich kein Schlussstrich ziehen.“
Winkler hob hervor, dass es ein „deutsches Recht auf Wegsehen“ angesichts von Holocaust, anderen nationalsozialistischen Verbrechen und Zweitem Weltkrieg insgesamt nicht gebe. Diese begründeten kein Beiseitestehen Deutschlands in Fällen, wo es zwingende Gründe geben, zusammen mit anderen Staaten tätig zu werden. Jede tagespolitische Instrumentalisierung der Ermordung der europäischen Juden laufe auf eine Banalisierung dieser Verbrechen hinaus. Jeder Versuch, mit dem Hinweis auf den Nationalsozialismus eine deutsche Sondermoral zu begründen, führe in die Irre.
Als deutsche Verpflichtungen nannte Winkler die besonderen Beziehungen zu Israel und die Solidarität mit Ländern, die erst 1989/90 ihr Recht auf innere und äußere Selbstbestimmung wiedergewonnen haben. „Nie wieder dürfen Polen und die baltischen Republiken den Eindruck gewinnen, als werde zwischen Berlin und Moskau irgendetwas über ihre Köpfe hinweg und auf ihre Kosten entschieden.“
Bouffier: Kein Platz für Gegner von Demokratie und Menschenrechten
Bundesratspräsident Volker Bouffier zitierte zu Beginn seiner Rede Literaturnobelpreisträger Heinrich Böll: "Der Krieg wird niemals zu Ende sein, solange noch eine Wunde blutet, die er geschlagen hat." Die unendlich vielen Wunden seien heute Mahnung und Verpflichtung, der Opfer der nationalsozialistischen Gewaltherrschaft zu gedenken und aktiv für Frieden, Völkerverständigung, für Weltoffenheit und Toleranz einzutreten.
Heinrich August Winkler habe recht, dass die Einzigartigkeit dieses Geschehens es auch 70 Jahre nach Ende des Krieges nicht erlaube, einen Schlussstrich zu ziehen oder gar zu relativieren. Dazu gehöre, sich der eigenen Geschichte zu stellen und sich mit ihr auseinanderzusetzen, sagte Bouffier. Der 8. Mai verpflichte zum entschiedenen Eintreten für Frieden, für Freiheit und Demokratie und auch dazu "immer wieder deutlich zu machen, dass in Deutschland kein Platz ist für diejenigen, die die Demokratie bekämpfen oder die Menschenrechte missachten".
8. Mai 1945 - Epochenwechsel für ganz Europa
Mit dem Kriegsende habe nicht nur für Deutschland eine neue Epoche begonnen, sondern auch für ganz Europa, so Bouffier. Jahrhunderte alte Rivalitäten, militärische Kämpfe, territoriales Expansionsstreben und nationalstaatliche Überheblichkeit hätten sich am 8. Mai 1945 erschöpft. Demokratie und Menschenrechte seien unabdingbar gewesen, um Europa damals nicht scheitern zu lassen.
Seiner tiefsten Überzeugung nach waren und sind das vereinte Europa und die Europäische Union die richtige Antwort auf das Inferno zweier Weltkriege. "Grenzen zu überwinden, ohne Kriege gegensätzliche Interessen auszugleichen und gemeinsame Interessen wahrzunehmen, darin liegt die fundamentale Bedeutung des vereinten Europas."
Zwar sei dieses vereinte Europa nicht das Paradies, aber "ich kenne keine andere Staatengemeinschaft, in der die Menschenrechte, der Frieden, die Freiheit und das Recht besser gewahrt würden", sagte der Bundesratspräsident.
Er beendete seine Rede mit dem Aufruf, dass Respekt, Toleranz und Zivilcourage unser Tun bestimmen sollten, "nicht nur am 8. Mai, sondern jeden Tag und immer wieder aufs Neue".