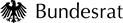Alle Länderminister waren zu dieser Reichsratssitzung am 30. Januar 1934 nach Berlin befohlen worden. Auf der Tagesordnung stand das Gesetz über den "Neuaufbau des Reichs". Mit ihm sollten die Hoheitsrechte der Länder auf das Reich übertragen und die Landesregierungen der Reichsregierung unterstellt werden.
Einziger Redner war der Vorsitzende des Reichsrates und Reichsinnenminister Wilhelm Frick. In einer enthusiastisch vorgetragenen Rede forderte er den Reichsrat eindringlich dazu auf, dem Gesetz "ohne langes Reden" zuzustimmen. Ohne Debatte und einstimmig tat dieser wie geheißen und beschloss, keinen Einspruch gegen das Gesetz einzulegen.
"Artikel 1: Die Volksvertretungen der Länder werden aufgehoben. Artikel 2: Die Hoheitsrechte der Länder gehen auf das Reich über. Die Landesregierungen unterstehen der Reichsregierung. Artikel 4: Die Reichsregierung kann neues Verfassungsrecht setzen."
Mit diesem Gesetz war das Ende für die Souveränität der Länder bereitet und der Untergang der bundesstaatlichen Ordnung in Deutschland besiegelt. Mit der Gleichschaltung wurde der Reichsrat als Vertreter der Länder überflüssig. Seine endgültige Auflösung folgte auf Erlass der Reichsregierung am 14. Februar 1934. Damit war den Weg in einen zentralistisch organisierten Führerstaat vollständig geebnet.
Abschaffung föderaler Strukturen

Zerschlagung des Föderalismus im Nationalsozialismus
© Deutsches Bundesarchiv
Die Demontage der föderalen Strukturen der Weimarer Republik hatte bereits kurz nach der Machtübernahme der Nationalsozialisten Anfang 1933 begonnen. Mit dem "Gesetz zur Behebung der Not von Volk und Reich" vom 24. März 1933, dem so genannten Ermächtigungsgesetz - das übrigens der Reichsrat einstimmig billigte, wurde auch die Mitwirkung der Länder bei der Gesetzgebung abgeschafft. Fortan konnte die Reichsregierung unter Hitler Gesetze auch ohne Zustimmung des Reichstages und ohne Behandlung im Reichsrat beschließen.
Nur eine Woche nach dem Ermächtigungsgesetz folgte am 31. März 1933 das "Vorläufige Gesetz zur Gleichschaltung der Länder mit dem Reich". Mit ihm ging das Recht zur Landesgesetzgebung von den Landtagen auf die Landesregierungen über. Außerdem verlangte es die Neubildung der Landtage gemäß der Stimmenzahl der Reichstagswahl 1933.
Infolge dessen veränderte sich auch die Zusammensetzung im Reichsrat. Sämtliche darin versammelten Bevollmächtigten wurden durch Nationalsozialisten ersetzt. Zug um Zug hatten die Nationalsozialisten ihre Macht auf alle politischen Institution ausgeweitet. Der parlamentarische Widerstand gegen die Errichtung eines totalitären Führerstaates war damit gebrochen.
Schwache Stellung des Reichsrats
Hervorgegangen war der Reichsrat aus dem Bundesrat des Deutschen Kaiserreichs. Im Unterschied zu seinem Vorgänger hatte der Reichsrat in der Weimarer Republik eine eher schwache Stellung im Staatsgefüge. Dies zeigt schon ein Blick in die Weimarer Reichsverfassung: Dort war der Reichsrat unter den obersten Reichsorganen an die letzte Stelle nach den Abschnitten "Reichstag", "Reichspräsident und Reichsregierung" gerückt.
Er hatte nicht einmal das Recht, sich selbst zu versammeln und konnte auch nicht über seinen Vorsitz selbst bestimmen. Diesen übernahm ein Mitglied der Reichsregierung, in der Regel der Innenminister.

Die große Verfassungsfeier der Reichsregierung am 11. August 1932 in Berlin
© Deutsches Bundesarchiv
Die Stimmen im Reichsrat waren mit Ausnahme Preußens proportional entsprechend der Einwohnerzahlen der Länder verteilt. Vertreten wurden die Länder verfassungsgemäß durch Mitglieder ihrer Regierungen, die so genannten Bevollmächtigten. In der Praxis jedoch nahmen Landesminister eher selten an Reichsratssitzungen teil und ließen sich von Landesbeamten vertreten.
Tagungsort war der Sitzungssaal des ehemaligen Bundesrates im Berliner Reichstagsgebäude. Die Sitzungen waren öffentlich, das Interesse daran jedoch sehr begrenzt. Meist war gerade mal ein gemeinsamer Pressevertreter zugegen.
Einspruchsrecht bei allen Gesetzen
Zu den verfassungsmäßigen Aufgaben des Reichsrates gehörte die Mitwirkung bei der Gesetzgebung und der Verwaltung des Reiches. So musste jede Vorlage der Reichsregierung vor Einbringung in den Reichstag dem Reichsrat vorgelegt werden. Stimmte der Reichsrat nicht mit dem Regierungsvorhaben überein, konnte die Regierung ihren Gesetzentwurf trotzdem einbringen, musste aber die abweichende Auffassung des Reichsrates darlegen.
In der Weimarer Republik wurden Gesetze allein vom Reichstag beschlossen, jedoch verfügte der Reichsrat bei allen Gesetzen über ein Einspruchsrecht. Ein solcher Einspruch konnte nur mit einer Zwei-Drittel-Mehrheit vom Reichstag zurückgewiesen werden. Wollte die Reichsregierung ihre Gesetzesvorhaben also nicht gefährden, musste sie bereits frühzeitig auf die Interessen des Reichsrates Rücksicht nehmen.