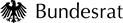- Es gilt das gesprochene Wort.-
Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich eröffne die 929. Sitzung des Bundesrates.
Wir gedenken heute der Opfer des nationalsozialistischen Völkermordes an den Sinti und Roma sowie der Gruppe der Jenischen.
Meine Damen und Herren, unter unseren Gästen sind Überlebende dieser Verbrechen, Angehörige und Nachkommen der Opfer. Es ist uns eine große Ehre und wir freuen uns, dass Sie heute bei uns sind. Ich begrüße herzlich die Vertreter des Zentralverbandes der deutschen Sinti und Roma sowie die Vertreter des Verbandes der Jenischen. Vielen Dank für Ihr Kommen, meine Damen und Herren.
Sie alle leisten einen unermüdlichen Dienst, einen unverzichtbaren Dienst, einen Dienst gegen das Vergessen. Sie geben den Opfern eine Stimme, eine mahnende Stimme, und damit erinnern Sie an das entsetzliche Grauen, das vielen Menschen widerfahren ist. Wir gedenken heute zum einen, damit es nicht vergessen wird, zum anderen, um uns zu mahnen.
Sie geben aber auch denjenigen eine Stimme, die heute wieder auf Ablehnung, auf Vorurteile stoßen, denen Misstrauen entgegenschlägt, die Ausgrenzung spüren.
Und Sie sind eine warnende Stimme, die uns aufmerksam macht und uns handeln lässt.
Wir wollen mit dieser Gedenkstunde auch daran erinnern, dass der Einsatz für Demokratie, Frieden und Freiheit, Toleranz und Anerkennung, letztlich im besten Sinne des Wortes der Einsatz für Menschlichkeit, immer wieder neu gelebt werden muss.
Meine Damen und Herren, vor 72 Jahren in diesen Tagen - genau: vor drei Tagen -, am 16. Dezember, entschied Heinrich Himmler über das Schicksal von 23 000 Menschen, von denen wir wissen. Alle im Deutschen Reich lebenden Sinti und Roma wurden nach Auschwitz deportiert. So gut wie niemand hat diese Hölle überlebt. Insgesamt löschten die Nationalsozialisten das Leben von mehr als einer halben Million Sinti und Roma aus. Die Zahl der ermordeten Jenischen ist uns nicht bekannt. Das waren 500 000 Menschen - Männer und Frauen, Eltern, Großeltern, Kinder, Schwestern und Brüder - mit ihren Träumen, mit ihren Hoffnungen, wie auch jeder von uns sie hat. Sie wurden ermordet, weil sie Sinti und Roma waren, weil sie als Jenische geboren wurden, weil sie als anders empfunden wurden.
Uns muss es heute darum gehen, ihnen ein würdiges Andenken zu bewahren, aber nicht nur heute, sondern an jedem Tag.
Wir wollen heute unsere Gedanken, unser Denken, unser Andenken sichtbar machen, und wir möchten möglichst viele Menschen damit erreichen. Wir wollen die Erinnerung an diese dunkelsten Stunden unseres Landes im besten Sinne des Wortes auch erfahrbar machen, damit sie uns nachdenklich machen. Die Erinnerung macht das Geschehene nicht ungeschehen. Doch die Auseinandersetzung mit der Geschichte ist unverzichtbar, damit wir Lehren für Gegenwart und Zukunft ziehen.
Wenn wir heute der Sinti und Roma sowie der Jenischen gedenken, die Opfer des Nationalsozialismus geworden sind, müssen wir auch daran erinnern, dass dies nicht die ganze Geschichte ist, die Sinti und Roma erfahren haben. Es ist eine jahrhundertelange Geschichte der Ausgrenzung und der Diskriminierung. Es begann nicht erst mit dem Nationalsozialismus, und es endete nicht mit dem Zweiten Weltkrieg. Erst 1982 wurde der nationalsozialistische Mord an den Sinti und Roma offiziell als Völkermord anerkannt.
Im Jahr 2012 nimmt Schleswig-Holstein als erstes Land die Sinti und Roma als Minderheit in die Landesverfassung auf, 600 Jahre nach der ersten urkundlichen Erwähnung der Sinti und Roma. Dies war ein bedeutender Schritt, es war vor allen Dingen ein Signal. Mittlerweile - ich denke, darüber freuen wir alle uns - ist eine Reihe von Ländern gefolgt. Sie haben Rahmenvereinbarungen unterzeichnet, um konkret Anerkennung und Teilhabe der Sinti und Roma zu unterstützen. Dazu gehören auch Maßnahmen gegen die Diskriminierung sowie die Förderung der kulturellen Identität und Sprache. Ich wünsche mir sehr, dass dies intensiv fortgesetzt und mit Leben erfüllt wird. Wir sind uns der politischen und historischen Verantwortung bewusst und arbeiten konsequent weiter daran, die Lebensbedingungen konkret zu verbessern.
Ein Meilenstein war die Einrichtung und Eröffnung des Mahnmals für die Sinti und Roma, die Opfer des Rassenwahns wurden, in Berlin. Solche Gedenkstätten sind wichtig, sie sind Stätten der Erinnerung und Mahnung. Sie sollen aber auch Richtschnur für die Zukunft sein.
Liebe Kolleginnen und Kollegen, meine sehr verehrten Damen und Herren, neben diesen öffentlichen Gedenkstätten sind die Grabstätten der von dem nationalsozialistischen Terrorregime getöteten Sinti und Roma sowie Jenischen oft die einzigen Erinnerungsorte für die Hinterbliebenen. Einige Länder haben mittlerweile den Erhalt der Grabstätten als Familiengedächtnisstätten vertraglich vereinbart. Aber - wir sind im intensiven Gespräch - wir alle bleiben aufgefordert, dafür eine gemeinsame Regelung zu finden.
Bei der Einweihung des Berliner Mahnmals sprach der Sinto Zoni Weisz. Als Siebenjähriger konnte er als Einziger seiner Familie der Deportation nach Auschwitz entkommen. Er formulierte wie folgt - Zitat -:
Wir müssen Lehren aus der Geschichte ziehen. Es kann und darf nicht sein, dass unsere Lieben umsonst gestorben sind, dass wir nichts aus der Geschichte gelernt haben. Wir haben die Aufgabe, die Voraussetzungen zu schaffen, dass Minderheiten in Frieden und Sicherheit leben können.
Ich habe dies deshalb zitiert, weil Zoni Weisz genau die Brücke beschreibt zwischen Vergangenheit und Zukunft, die das ist, was wir Erinnerung nennen.
Der nationalsozialistische Völkermord an den Sinti und Roma ist Teil unseres historischen Gedächtnisses. Daraus erwächst die gemeinsame Verantwortung für die Zukunft, die bedeutet, sich entschieden und mit aller Kraft immer wieder gegen jede Form von Extremismus, Rassismus, besonders aber jede Form von Antisemitismus und Antiziganismus einzusetzen. Für eine Demokratie ist kaum etwas gefährlicher als Unwissenheit und Gleichgültigkeit. Das Hinsehen, das Anteilnehmen, das Sich-in-andere-Hineinfühlen und Eingreifen, wenn die Würde eines anderen verletzt wird, so stelle ich mir unsere gemeinsame Verpflichtung vor.
Meine Damen und Herren, wenn Sie sich die Studie der Antidiskriminierungsstelle des Bundes ansehen, die noch nicht sehr lange vorliegt, müssen wir feststellen: Wir haben einige wichtige Zwischenetappen gemeinsam erreicht. Aber der Weg ist noch lang. Noch immer gilt es, gerade in den Köpfen viele Grenzen zu überwinden. Veranstaltungen wie heute können dazu einen Beitrag leisten. Sie dienen in erster Linie natürlich dem Gedenken der Opfer, sie können aber auch unseren Blick schärfen. Sie können und müssen uns nachdenklich machen. Sie sollen uns insbesondere dazu befähigen zu tun, was wir tun können.
In diesem Zusammenhang möchte ich bewusst eine Entwicklung ansprechen, die mich - ich denke, viele von uns - besorgt. In etlichen Städten Deutschlands gehen derzeit Bürger auf die Straße und demonstrieren gegen die angebliche Islamisierung Deutschlands und Europas. Ja, mancher sagt, er fühle sich fremd im eigenen Land. Was sich da vermeintlich, wirklich, aus dem Nichts, plötzlich zeigt, dürfen wir nicht ignorieren. Dort tummeln sich ganz unterschiedliche Rechtsextreme, Ewiggestrige, Menschen, die politisch und gesellschaftlich häufig nicht mehr von uns erreicht werden, aber auch viele sogenannte normale Bürger, Menschen, die Angst haben um die Zukunft, Ängste, die nach meiner festen Überzeugung unbegründet sind.
Aber, meine Damen und Herren, wir werden diesen Menschen die Ängste nicht nehmen, wenn wir sie ignorieren. Deshalb ist es meine feste Überzeugung: So etwas dürfen wir nicht ignorieren. Wir dürfen es auch nicht dämonisieren. Es ist die Pflicht aller gesellschaftlichen Gruppen, nicht nur der Parteien, diese Themen aufzunehmen, klar Position zu beziehen, sachlich aufzuklären und das Gespräch zu suchen. Dabei werden wir vielleicht nicht immer jeden erreichen. Aber den Versuch, die Menschen zu erreichen, sie zu überzeugen, müssen wir immer wieder unternehmen.
Dabei muss eines klar sein: Dumpfe Angstparolen, Ausgrenzung, Intoleranz oder gar Gewalt finden niemals unsere Nachsicht oder gar unser Verständnis, sie finden unseren entschlossenen Widerstand.
Wenn wir heute gedenken, lassen Sie uns die Erinnerung daran wachhalten, was passiert, wenn Unwissenheit, Ablehnung und Vorurteile sich bis zu tödlichem Hass verdichten!
Lassen Sie mich zum Schluss den österreichischen Schriftsteller und Überlebenden der Schoah, Jean Améry, zitieren; das Zitat findet sich auf einer Gedenktafel des ehemaligen Verwaltungshauptgebäudes der IG Farben in Frankfurt am Main:
Niemand kann aus der Geschichte seines Volkes austreten. Man soll und darf die Vergangenheit nicht auf sich beruhen lassen, weil sie sonst auferstehen und zu neuer Gegenwärtigkeit werden könnte.
Meine Damen, meine Herren, ich bitte Sie nun, sich von Ihren Plätzen zu erheben, um der Opfer nationalsozialistischer Gewalt unter den Sinti und Roma, den Angehörigen der eigenständigen Gruppe der Jenischen und anderen Fahrenden zu gedenken.