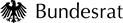| TOP | Thema |
|---|---|
| 1 | Antrittsrede des Präsidenten |
| 5 | Änderung des Bundeswahlgesetzes |
| 10 | Verbesserung der grenzüberschreitenden Arbeitsförderung |
| 11 | Änderung des Gemeinnützigkeitsrechts |
| 12 | Beschleunigtes Verfahren im Jugendgerichtsgesetz |
| 13 | Feststellung der Verfassungswidrigkeit der NPD |
| 15 | Abschaffung des sozialversicherungsrechtlichen Antragsverfahrens |
| 16 | Schutz kombinierter Qualitäts- und Herkunftszeichen |
| 17 | Entschließung zur Charta der Grundrechte in der Europäischen Union |
| 18 | Rücklage für witterungsbedingte Schadensereignisse |
| 19 | Abwehr von Gefahren durch BSE |
| 20 | Sicherung der Abgabe von Hilfsmitteln durch Gesundheitshandwerker |
| 21 | Verwertung von Genomanalysen in der Versicherungswirtschaft |
| 22 | Bekämpfung von Rechtsextremismus und Fremdenfeindlichkeit |
| 23 | Neu- und Ausbaumaßnahmen der Eisenbahninfrastruktur |
| 25 | Ausbildungsförderungsreform |
| 26 | Reform des Zivilprozesses |
| 50 | Änderung straßenverkehrsrechtlicher Vorschriften |
| 51 | Vergabeverordnung |
| 56 a | Änderung des Grundgesetzes (Artikel 16) |
| 56 b | Internationaler Strafgerichtshof |
| 57 | Weiterentwicklung der Europäischen Union |
| 58 | Recht auf Familienzusammenführung |
| 59 | Verbesserung der steuerlichen Behandlung von Internet und PC |
TO-Punkt 1
Ansprache des Präsidenten
Bundesratspräsident Kurt Beck (Rheinland-Pfalz) wird zu Beginn seiner Amtszeit eine Antrittsrede vor dem Bundesrat halten.
TO-Punkt 5
Fünfzehntes Gesetz zur Änderung des Bundeswahlgesetzes
- Drucksache 638/00 -
Das auf eine Initiative der Fraktionen SPD und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN zurückgehende Gesetz hat die Änderung des Bundeswahlgesetzes zum Ziel. Eine wesentliche Neuerung betrifft die Erstattung der Bundestagswahlkosten. Die Wahlkostenabrechnung erfolgt bislang per durchschnittbildender Pauschalierung. Dies hat regelmäßig zur Folge, dass einzelne Länder höhere Erstattungen bekommen, als sie Kosten geltend gemacht haben, während andere Länder mit den Erstattungen hinter den geltend gemachten Forderungen zurück bleiben. Grundlage für die Berechnung der Wahlkostenerstattung soll nunmehr eine Kombination aus der genauen Abrechnung entstandener Kosten und der Festsetzung eines bundeseinheitlichen Durchschnittsbetrages je Wahlberechtigten sein. Damit folgt das Gesetz entsprechenden Vorschlägen des Bundesrates aus den Jahren 1995 bzw. 1999. Außerdem soll die Zahl der Beisitzer, die in die Wahlvorstände berufen werden können, auf bis zu sieben erhöht werden. Da es in den letzten Jahren zunehmend schwieriger geworden sei, eine ausreichende Anzahl von geeigneten ehrenamtlichen Wahlhelfern zu gewinnen, sollen Behörden verpflichtet werden, ihre Bediensteten für eine Berufung als Mitglieder des Wahlvorstandes zu benennen.
Um Kosten zu sparen, die Feststellung des Wahlergebnisses zu beschleunigen und die Stimmabgabe zu erleichtern soll darüber hinaus künftig auf die Verwendung von amtlichen Briefumschlägen bei der Urnenwahl verzichtet werden. Zur Harmonisierung des Wahlrechts mit dem Melderecht sieht das Gesetz weiterhin vor, die öffentliche Auslegung des Wählerverzeichnisses abzuschaffen. In Zukunft soll die Einsicht in das Wählerverzeichnis grundsätzlich nur auf die Angaben zur eigenen Person beschränkt sein. Die Einsicht in das Wählerverzeichnis zur Kontrolle von Daten anderer Personen soll nur in begründeten Einzelfällen erfolgen können. In Umsetzung der vom Bundesverfassungsgericht genannten Anforderungen an die Aufstellung von Bewerbern durch Parteien, räumt das Gesetz jedem stimmberechtigten Teilnehmer einer Mitglieder- oder Vertreterversammlung das Recht ein, Wahlvorschläge zu unterbreiten. Jeder Bewerber soll darüber hinaus ausreichend Gelegenheit erhalten, sein Programm vorzustellen.
Ausschussempfehlungen 638/1/00:
Der Ausschuss für Innere Angelegenheiten empfiehlt dem Bundesrat, zu dem Gesetz die Einberufung des Vermittlungsausschusses aus mehreren Gründen zu verlangen.
Die ersatzlose Streichung der Gemeindegrößeklassen aus der bisherigen Erstattungssystematik führe dazu, dass Zuschläge für größere Kommunen entfallen. Deshalb soll der Bund den Ländern die so genannten "Restkosten" durch einen festen Betrag pro Wahlberechtigten erstatten. Dieser soll für die nächste Bundestagswahl 0,45 EURO betragen. Für die folgenden Wahlen kann sich dieser Betrag nach Ansicht des Innenausschusses entsprechend der bis zum jeweiligen Wahltag erfolgten linearen Entwicklung der Grundvergütung für Angestellte der Kommunen in der Vergütungsgruppe V b BAT erhöhen oder ermäßigen. Außerdem sei es sinnvoll, dass Wahlscheininhaber nur noch an der Urnenwahl in dem Wahlbezirk teilnehmen dürfen, in dessen Wählerverzeichnis sie geführt werden. Darüber hinaus empfiehlt der Ausschuss die Einführung der neuen Terminologie des "Stimmzettelumschlags" anstelle des "Wahlumschlags" rückgängig zu machen, weil der entstehende Aufwand in keinem vertretbaren Verhältnis zum Ertrag stehe. Schließlich rät der Innenausschuss, festzustellen, dass das Gesetz der Zustimmung des Bundesrates bedarf, da es mehrere Regelungen über das Verwaltungsverfahren enthalte.
TO-Punkt 10
Entwurf eines Gesetzes zur Verbesserung der grenzüberschreitenden Arbeitsförderung im Rahmen des SGB III
- Antrag des Saarlandes -
- Drucksache 550/99 -
Durch den Gesetzentwurf des Saarlandes soll die Möglichkeit geschaffen werden, die arbeitsmarktpolitischen Instrumente künftig auch grenzüberschreitend einzusetzen. Nach der Vorstellung des Saarlandes sollen die Arbeitsämter losgelöst vom Territorialprinzip bestimmte Instrumente der aktiven Arbeitsförderung im grenznahen Ausland einsetzen können. Bislang ist eine Förderung von Personen, Maßnahmen und Projekten im Ausland auf Ausnahmen beschränkt. Der Aktionsradius grenznaher Arbeitsämter sei dadurch stark eingeschränkt, Arbeitsangebote aus dem grenznahen Ausland blieben ungenutzt.
Ausschussempfehlungen 365/1/00:
Der federführende Ausschuss für Arbeit und Sozialpolitik empfiehlt dem Bundesrat, den Gesetzentwurf nach Maßgabe von einigen Änderungen beim Deutschen Bundestag einzubringen. Unter anderem soll nach Auffassung des Ausschusses der Leistungsexport grundsätzlich auf die Mitgliedstaaten der Europäischen Union beschränkt bleiben. Andererseits sollen Maßnahmen der Arbeitsförderung in angrenzenden osteuropäischen Staaten nicht völlig ausgeschlossen werden. Insgesamt sollte der Anwendungsbereich des Gesetzes auf Maßnahmen im Tagespendelbereich liegender Gebiete begrenzt sein. Schließlich spricht sich der Ausschuss zunächst für eine Befristung des Gesetzes bis zum 30. Juni 2004 aus.
Der Finanzausschuss, der Ausschuss für Kulturfragen und der Wirtschaftsausschuss empfehlen dagegen, den Gesetzentwurf unverändert beim Deutschen Bundestag einzubringen.
TO-Punkt 11
Entwurf eines Gesetzes zur Änderung der Abgabenordnung
- Antrag des Landes Hessen -
- Drucksache 668/00 -
Mit dem Gesetzesantrag möchte Hessen Körperschaften, die sich unter anderem die generationsübergreifende Nachbarschaftshilfe zum Ziel gesetzt haben, durch die Anerkennung der Gemeinnützigkeit steuerlich entlasten und ihnen damit zugleich die Möglichkeit eröffnen abzugsfähige Spenden zu empfangen. Diese Möglichkeit soll auch für die von engagierten Bürgerinnen und Bürgern gegründeten so genannten Freiwilligen-Zentren und -Agenturen, die es sich zur Aufgabe gemacht haben, das ehrenamtliche bürgerschaftliche Engagement in den steuerbegünstigten Bereichen zu fördern, geschaffen werden. Auch der Feuerschutz, der bereits derzeit allgemein als besonders förderungswürdig im Sinne des Einkommensteuerrechts anerkannt ist, sollte ausdrücklich als gemeinnütziger Zweck im Gesetz genannt werden. Im Einzelnen sollen die entsprechenden Vorschriften des Gemeinnützigkeitsrechts nach der Abgabenordnung im Hinblick auf die Grundsätze der Selbstlosigkeit und Unmittelbarkeit geändert und der Feuerschutz und die Nachbarschaftshilfe als gemeinnützige Zwecke normiert werden.
Ausschussberatungen haben noch nicht stattgefunden. Das antragstellende Land wird die Vorlage in der Sitzung des Bundesrates vorstellen und der Präsident sie anschließend den Ausschüssen zur weiteren Beratung zuweisen.
TO-Punkt 12
Entwurf eines Gesetzes zur Änderung des Jugendgerichtsgesetzes
- Antrag des Freistaates Thüringen -
- Drucksache 549/00
Der Freistaat Thüringen möchte mit dem Gesetzentwurf das beschleunigte Verfahren im Strafprozess auch für Jugendliche zulassen. Die in jüngster Zeit bekannt gewordenen Vorfälle, in denen Jugendliche auf frischer Tat ertappt, aber erst nach Wochen oder Monaten strafrechtlich hierfür zur Verantwortung gezogen worden seien, machten deutlicht, dass trotz eindeutiger Beweislage diesen Taten mit dem geltenden Recht nicht wirksam entgegengetreten werde. Nach dem geltenden Jugendgerichtsgesetz ist das beschleunigte Verfahren bei Jugendlichen unzulässig. Gerade im Jugendstrafrecht sei jedoch - so das antragstellende Land - der zeitliche Abstand zwischen Tat, Verurteilung und Vollstreckung von besonderer erzieherischer Bedeutung. Nur eine Sanktion, die der Tat auf dem Fuße folge, könne die gewünschte erzieherische Wirkung bei dem jugendlichen Straftäter entfalten.
Ausschussempfehlungen 549/1/00:
Der federführende Rechtsausschuss empfiehlt, den Gesetzentwurf in einer geänderten Fassung beim Deutschen Bundestag einzubringen. Danach soll dem Jugendrichter die Erzwingung der Anwesenheit des Angeklagten auch im vereinfachten Jugendverfahren ermöglicht werden. Der Ausschuss für Innere Angelegenheiten empfiehlt die unveränderte Einbringung des Gesetzentwurfs, der Ausschuss für Frauen und Jugend empfiehlt, den Gesetzentwurf beim Deutschen Bundestag nicht einzubringen.
TO-Punkt 13
Antrag auf Entscheidung des Bundesrates über die Einleitung eines Verfahrens zur Feststellung der Verfassungswidrigkeit der "Nationaldemokratischen Partei Deutschlands" (NPD) gemäß Artikel 21 Abs. 2 Grundgesetz i.V.m. § 13 Nr. 2, §§ 43 ff. Bundesverfassungsgerichtsgesetz
- Antrag der Länder Bayern, Niedersachsen -
- Drucksache 673/00 -
Der Antrag der beiden Länder hat zum Ziel, einen Beschluss des Bundesrates folgenden Inhalts herbeizuführen:
"Die Nationaldemokratische Partei Deutschlands (NPD) ist verfassungswidrig.
Die NPD wird aufgelöst.
Es ist verboten, Ersatzorganisationen für die NPD zu schaffen oder bestehende Organisationen als Ersatzorganisationen fortzusetzen.
Das Vermögen der NPD wird zu Gunsten der Bundesrepublik Deutschlands zu gemeinnützigen Zwecken eingezogen. "
Der Beschluss des Bundesrates soll weiter beinhalten, dass der Präsident des Bundesrates einen Prozessbevollmächtigten mit der Antragstellung, Begründung und Prozessführung beauftragt.
Die Begründung des Verbotsantrages soll sich unter anderem an der von der Innenministerkonferenz vorgenommenen Bewertung der zusammengetragenen Materialien über die NPD orientieren. Auf Grund dieser Materialien bestehe die Überzeugung, so die antragstellenden Länder, dass die NPD eine verfassungswidrige Partei sei. Die NPD gehe nach ihren Zielen und dem Verhalten ihrer Anhänger darauf aus, die freiheitlich demokratische Grundordnung zu beeinträchtigen oder sogar zu beseitigen. Ein Verbot der NPD sei daher erforderlich.
Die Vorlage wird voraussichtlich in der Plenarsitzung näher begründet. Die Antragsteller haben sofortige Sachentscheidung beantragt.
TO-Punkt 15
Entschließung des Bundesrates zur Abschaffung des sozialversicherungsrechtlichen Anfrageverfahrens bei der Bundesversicherungsanstalt für Angestellte
- Antrag des Landes Baden-Württemberg -
- Drucksache 566/00 -
Nach Auffassung des antragstellenden Landes soll der Bundesrat den Deutschen Bundestag und die Bundesregierung auffordern, die Vorschriften im Gesetz zur Förderung der Selbstständigkeit aufzuheben, nach denen vorrangig die Bundesversicherungsanstalt für Angestellte im so genannten "Anfrageverfahren" darüber entscheidet, ob eine sozialversicherungspflichtige Beschäftigung vorliegt. Die Regelung hätte sich nicht bewährt. Zur Begründung des Antrags wird weiter ausgeführt, dass das Ziel, einen Beitrag zur raschen Klärung des sozialversicherungsrechtlichen Status insbesondere von Existenzgründern zu leisten, nicht erreicht worden sei. Das Verfahren sei bürokratisch und langwierig. Die langanhaltende Ungewissheit über ihren sozialversicherungsrechtlichen Status belaste und verunsichere vor allem Existenzgründer. Außerdem führe die Verzögerung in der Entscheidung durch die Bundesversicherungsanstalt für Angestellte dazu, dass auch der Zeitpunkt, ab dem die Sozialversicherungsträger den ihnen zustehenden Betrag erheben können, hinaus geschoben werde. Die Folge seien nennenswerte Beitragsausfälle und damit eine Beeinträchtigung der Finanzierungsgrundlagen der Sozialversicherung. Ferner habe die Neuregelung die bewährte Zuständigkeit der bislang allein zur Entscheidung berufenen Krankenkassen als Einzugsstellen ausgehebelt und zur Zersplitterung der Zuständigkeiten geführt. Schließlich stelle die Regelung eine eindeutige Präjudizierung der noch nicht abgeschlossenen Verhandlungen zwischen Bund und Ländern zur Organisationsform der gesetzlichen Rentenversicherung dar.
Ausschussempfehlungen 566/1/00:
Der federführende Ausschuss für Arbeit und Sozialpolitik sowie der Gesundheitsausschuss empfehlen dem Bundesrat, die Entschließung nicht zu fassen.
Im Finanzausschuss und im Wirtschaftsausschuss sind Empfehlungen an das Plenum nicht zu Stande gekommen.
TO-Punkt 16
Entschließung des Bundesrates zum Schutz kombinierter Qualitäts- und Herkunftszeichen
- Antrag des Freistaates Bayern -
- Drucksache 40/00 -
Mit dem Entschließungsantrag des Freistaates Bayern soll die Bundesregierung aufgefordert werden, bei der Kommission und dem Rat der Europäischen Union geeignete Initiativen zu ergreifen, dass umgehend ein Rahmenrecht zur Zulassung regionaler, kombinierter Qualitäts- und Herkunftszeichen geschaffen wird. Die bereits bestehende Verordnung 2081/92 hält das antragstellende Land nicht für ausreichend, da diese lediglich die Bezeichnung spezifischer, durch ihre Herkunft geprägter Produkte schützt. Darüber hinaus wird ein Schutz kombinierter Qualitäts- und Herkunftsbezeichnungen für notwendig erachtet, weil eine wachsende Verbraucherverunsicherung und eine daraus resultierende Kaufzurückhaltung zu verzeichnen seien. Deshalb müssten nationale bzw. regionale Programme eingeführt werden dürfen, die dem Verbraucher gleichzeitig kontrollierte Qualität und die Herkunft des nachgefragten Erzeugnisses garantierten.
Ausschussempfehlungen 40/1/00:
Der federführende Ausschuss für Fragen der Europäischen Union und der Gesundheitsausschuss empfehlen dem Bundesrat, die Entschließung nach Maßgabe von Änderungen zu fassen. Der Agrarausschuss empfiehlt demgegenüber, die Entschließung in unveränderter Form anzunehmen.
TO-Punkt 17
Entschließung des Bundesrates zum Entwurf der Charta der Grundrechte der Europäischen Union
- Antrag des Freistaates Thüringen -
- Drucksache 666/00 -
- zu Drucksache 666/00 -
Im thüringischen Entschließungsantrag wird der Entwurf der Charta der Grundrechte als ausgewogener und tragfähiger Kompromiss und wesentlicher Schritt zu einem Europa der Bürger gewürdigt. Der Bundesrat soll nach Ansicht Thüringens feststellen, dass die Charta die Rechtsstellung der in Europa lebenden Menschen verstärken und die Kontrolle der europäischen Hoheitsgewalt verbessern wird. Im Antrag wird weiterhin begrüßt, dass durch die Teilnahme von Vertretern der Länder im Konvent wesentliche Anliegen und Forderungen der deutschen Länder - wie sie insbesondere in vorangegangenen Entschließungen des Bundesrates vom März und Juli 2000 zum Ausdruck gekommen sind - in den Chartaentwurf eingeflossen sind. Nach Auffassung Thüringens soll der Bundesrat allerdings bedauern, dass in den Verhandlungen keine klarere Unterscheidung zwischen individuell einklagbaren Rechten auf der einen und bloßen Zielbestimmungen oder "Grundsätzen" auf der anderen Seite zu erreichen war.
Ausschussempfehlungen 666/1/00:
Der Ausschuss für Fragen der Europäischen Union empfiehlt dem Bundesrat, die Entschließung nach Maßgabe einer Änderung zu fassen.
TO-Punkt 18
Entschließung des Bundesrates zur Einführung einer steuerfreien Rücklage für witterungsbedingte Schadensereignisse in der Land- und Forstwirtschaft
- Antrag des Landes Baden-Württemberg -
- Drucksache 561/00 -
Mit der Entschließung sollen der Deutsche Bundestag und die Bundesregierung aufgefordert werden, im Einkommensteuerrecht die Möglichkeit zur Bildung einer steuerfreien Rücklage für witterungsbedingte Schadensereignisse für Land- und Forstwirte zu schaffen. Damit sollen die steuerlichen Folgen naturbedingter Ertragsschwankungen abgemildert werden. Teile des Gewinns der Land- und Forstwirte würden nach Umsetzung der Entschließung durch den Gesetzgeber einer steuerfreien Rücklage zugeführt. Bei Eintritt eines Schadenfalles würde diese dann wieder aufgelöst werden. Auf diese Weise könnte der Land- oder Forstwirt zukünftig selbstständig Vorsorge für witterungsbedingte Schadensfälle treffen.
Ausschussempfehlungen 561/1/00:
Der Agrarausschuss empfiehlt dem Bundesrat, die Entschließung nach Maßgabe von Änderungen anzunehmen. Der federführende Finanzausschuss empfiehlt dem Bundesrat, die Entschließung nicht zu fassen.
TO-Punkt 19
Entschließung des Bundesrates zur Abwehr von Gefahren durch die Bovine Spongiforme Enzephalopathie und zur Rücknahme der Lockerung des Importverbotes für britisches Rindfleisch
- Antrag der Länder Saarland, Bayern und Baden-Württemberg -
- Drucksache 548/00 -
Der Entschließungsantrag der Länder Saarland, Bayern und Baden-Württemberg bezieht sich auf einen Beschluss des Bundesrates vom Dezember 1998, in dem der Bundesrat die Auffassung vertrat, dass eine Lockerung des Importverbotes für britisches Rindfleisch verfrüht sei. Die Bundesregierung soll mit dem vorliegenden Entschließungsantrag aufgefordert werden, alle Möglichkeiten zu nutzen, den Import britischen Rindfleisches nach Deutschland zu verhindern, da die Voraussetzungen für eine Lockerung noch nicht oder nur unzureichend erfüllt seien. Zur Begründung führen die antragstellenden Länder aus, dass sich die Hoffnungen auf eine EU-weite einheitliche amtliche Kennzeichnung durchgehend bis zum Verbraucher nicht erfüllt hätten. Eine Kennzeichnungsregelung sei außer von Großbritannien weder von anderen Mitgliedstaaten noch von Drittländern erlassen worden. Darüber hinaus steige nach Aussagen britischer Wissenschaftler die Zahl der von der Variante der Creutzfeldt-Jakob-Krankheit Betroffenen in Großbritannien seit 1995 jährlich um jeweils ca. 25 Prozent. Die Krankheit wird mit dem Verzehr von Rindfleisch vor dem In-Kraft-Treten des Verfütterungsverbotes von Fleischknochenmehl an Wiederkäuer in Zusammenhang gebracht. Ferner habe das britische Landwirtschaftsministerium mitgeteilt, dass auch eine nach dem 1. August 1996 geborene Kuh an BSE erkrankt sei. Dieser Fall belege, dass noch immer ein Restrisiko für die Verbraucher bestehe.
Der federführende Gesundheitsausschuss und der Agrarausschuss haben ihre Beratungen nicht abgeschlossen. Das Saarland hat dennoch die Behandlung im Plenum am 10. November und sofortige Sachentscheidung beantragt.
TO-Punkt 20
Entschließung des Bundesrates zur Sicherung der Abgabe von Hilfsmitteln durch Gesundheitshandwerker
- Antrag des Landes Baden-Württemberg -
- Drucksache 559/00 (neu) -
Der Entschließungsantrag des Landes Baden-Württemberg hat zum Ziel, die Tätigkeiten von Ärzten und Gesundheitshandwerkern im Hilfsmittelbereich besser von einander abzugrenzen. Durch Ergänzung der entsprechenden Vorschrift im Fünften Buch Sozialgesetzbuch soll klargestellt werden, dass Vertragsärzte grundsätzlich nicht zur Hilfsmittelversorgung zugelassen sind. Anderes solle nur gelten, wenn der Bundesausschuss Ärzte und Krankenkassen - unter Einbeziehung der Stellungnahme der Verbände der Hilfsmittelerbringer - in den Heil- und Hilfsmittelrichtlinien Indikatoren bestimmt habe, bei denen eine Abgabe von Hilfsmitteln unmittelbar durch den Arzt geboten sei. Zur Begründung führt Baden-Württemberg an, dass sich die Grenzen zwischen ärztlicher Tätigkeit und den Aufgaben des Gesundheitshandwerks zunehmend verwischten. Ärzte beschränkten sich nicht mehr nur darauf, Hilfsmittel lediglich zu verordnen, sondern gäben diese auch vermehrt selbst ab (zum Beispiel Fertigbrillen, Kontaktlinsen, Hörgeräte etc.). Auf diese Weise ließen sich Ärzte in die Vertriebssysteme von Hilfsmittel-Herstellern und Versandhändlern einbinden, um finanzielle Vorteile aus dieser Kooperation zu ziehen. Das niedergelassene Gesundheitshandwerk werde bei diesen "verkürzten Vertriebswegen" umgangen und die Neutralität des Arztes, der das Hilfsmittel verschreibe, sei nicht mehr gewahrt. Außerdem fehlten dem Arzt, der dem Patienten Hilfsmittel anpasse, in aller Regel die handwerklich-technische Qualifikation und die entsprechende apparative Ausstattung, über die die niedergelassenen Gesundheitshandwerker verfügten (d. h. Augenoptiker, Hörgeräteakustiker, Orthopädietechniker, Orthopädieschuhmacher usw.).
Ausschussempfehlungen 559/1/00:
Der federführende Gesundheitsausschuss empfiehlt dem Bundesrat, die Entschließung nicht zu fassen. Der Ausschuss für Kulturfragen empfiehlt dem Bundesrat dagegen, die Entschließung anzunehmen.
TO-Punkt 21
Entschließung des Bundesrates gegen die Verwertung von Genomanalysen in der Privatversicherung
- Antrag des Landes Rheinland-Pfalz -
- Drucksache 530/00 -
Nach dem Entschließungsantrag des Landes Rheinland-Pfalz soll die Bundesregierung aufgefordert werden, gesetzlich zu verbieten, dass Genomanalysen zur Voraussetzung des Abschlusses eines Versicherungsvertrages gemacht werden. Versicherer sollen auch nicht berechtigt sein, nach genetischen Dispositionen zu fragen, die dem Antragsteller oder den von der Schweigepflicht entbundenen Ärzten auf Grund anderweitig durchgeführter Analysen bekannt sind. Ausnahmen sollen nur unter eng begrenzten Voraussetzungen möglich sein. Hintergrund des Antrags sind die Fortschritte der Wissenschaft bei der Entschlüsselung des menschlichen Erbguts, die zu Ankündigungen britischer Lebensversicherungen geführt haben, Gentests zur Voraussetzung bei Versicherungsverträgen zu machen. Die von der deutschen Versicherungswirtschaft abgegebene Selbstbeschränkung, sei nicht ausreichend.
Ausschussempfehlungen 530/1/00:
Der federführende Rechtsausschuss, der Gesundheitsausschuss und der Ausschuss für Innere Angelegenheiten empfehlen dem Bundesrat, die Entschließung zu fassen.
TO-Punkt 22
Entschließung des Bundesrates zur wirksameren Bekämpfung von Rechtsextremismus und Fremdenfeindlichkeit
- Antrag des Landes Baden-Württemberg -
- Drucksache 564/00 -
Mit der Entschließung soll die Bundesregierung aufgefordert werden, durch gezielte gesetzgeberische Maßnahmen die Bekämpfung des Rechtsextremismus zu erleichtern und zu effektivieren. Zur Begründung wird auf mittlerweile rund 9 000 gewaltbereite Personen und ca. 150 rechtsextremistische Organisationen verwiesen. Das Bundesamt für Verfassungsschutz sehe bei neonazisistischen Gruppierungen inzwischen Ansätze für eine terroristische Bedrohung. Vor diesem Hintergrund seien Rechtsextremismus und Fremdenfeindlichkeit mit Nachdruck zu bekämpfen.
Ausschussempfehlungen 564/1/00:
Der federführende Rechtsausschuss und der Ausschuss für Innere Angelegenheiten empfehlen, die Entschließung nach Maßgabe von Änderungen zu fassen. Hervorzuheben ist, dass das Sanktionsmittel des isolierten Fahrverbots bei allen Straftaten mit extremistischem und/oder fremdenfeindlichem Hintergrund angewendet werden können soll. Demgegenüber fordert der vorgelegte Entwurf noch einen Zusammenhang mit der Benutzung eines Kraftfahrzeuges. Weitere Forderungen sollen in entsprechende Prüfbitten umgewandelt werden. Der Ausschuss für Frauen und Jugend empfiehlt, die Entschließung nicht zu fassen.
TO-Punkt 23
Entschließung des Bundesrates zur Finanzierung von Neu- und Ausbaumaßnahmen der dem Schienenpersonennahverkehr dienenden Eisenbahninfrastruktur
- Antrag des Freistaates Bayern -
- Drucksache 601/00 -
Nach dem Entschließungsantrag des Freistaates Bayern soll der Bundesrat den Bund auffordern, im notwendigen Umfang im Schienenpersonennahverkehr auch Baukostenzuschüsse zu gewähren. Hintergrund ist, dass der Bund für den Neubau, Ausbau und Unterhalt der Eisenbahninfrastruktur der Eisenbahnen des Bundes unabhängig davon verantwortlich ist, ob die Eisenbahninfrastruktur dem Schienenpersonenfernverkehr, dem Schienenpersonennahverkehr oder dem Schienengüterverkehr dient. Diesem im Grundgesetz (Art. 87 e Absatz 4) normierten Infrastrukturauftrag des Bundes kommt der Bund nach Auffassung des antragstellenden Landes nicht nach. Die Praxis sei vielmehr, dass der Bund für den Neu- und Ausbau der dem Schienenpersonennahverkehr dienenden Eisenbahninfrastruktur anders als bei der Fernverkehrsinfrastruktur nur zinslose Darlehen gewähre. Das antragstellende Land verweist in der Begründung auf einen Beschluss der Verkehrsministerkonferenz, die einstimmig Baukostenzuschüsse für den Neu- und Ausbau der Schienenpersonennahverkehrsinfrastruktur vom Bund gefordert hat.
Ausschussempfehlungen 601/1/00:
Der federführende Verkehrsausschuss empfiehlt dem Bundesrat, die Entschließung nach Maßgabe von Änderungen zu fassen. Insbesondere soll der Ausbau der Schieneninfrastruktur in den neuen Ländern wegen bestehender Investitionsrückstände mit besonderer Geschwindigkeit erfolgen. Der Finanzausschuss und der Ausschuss für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit empfehlen dem Bundesrat demgegenüber, die Entschließung unverändert zu fassen.
TO-Punkt 25
Entwurf eines Gesetzes zur Reform und Verbesserung der Ausbildungsförderung - Ausbildungsförderungsreformgesetz (AföRG)
- Drucksache 585/00 -
Durch den vorliegenden Gesetzentwurf will die Bundesregierung die Ausbildungsförderung grundlegend reformieren. Neben erheblichen strukturellen Veränderungen sollen vor allem die Bedarfssätze und Freibeträge erheblich angehoben sowie die Höchstbeträge angepasst werden. Geplant ist außerdem, die Förderleistungen in den neuen und alten Bundesländern vollständig zu vereinheitlichen. Um die Abbrecherquote zu senken, soll der Studienabschluss dauerhaft gefördert werden. Nach dem Regierungsentwurf würden Studierende trotz Überschreitens der Regelstudienzeit für die Dauer der Abschlussphase ab Zulassung zur Abschlussprüfung einen Anspruch auf Förderung mit Bankdarlehen erhalten. Angestrebt ist außerdem, die Studienbedingungen für Studierende mit Kindern zu verbessern. Der Betreuungsaufwand soll bei der Förderung künftig bis zum 10. Lebensjahr statt wie bisher nur bis zum 5. Lebensjahr des Kindes berücksichtigt werden. Ein weiterer Schwerpunkt des Gesetzentwurfs ist die Internationalisierung der Förderung: Nach zwei Semestern in Deutschland soll das Studium innerhalb der EU - gegebenenfalls auch bis zum Abschluss - zu Inlandsätzen gefördert werden.
Ausschussempfehlungen 585/1/00:
Der federführende Ausschuss für Kulturfragen empfiehlt dem Bundesrat, zu dem Gesetzentwurf Stellung zu nehmen. Nach Ansicht des Kulturausschusses soll der Bundesrat die Bundesregierung bitten, die Freibeträge vom Vermögen des Auszubildenden von 6.000 Mark auf 10.000 Mark und für den Ehegatten und die Kinder von 2.000 Mark auf jeweils 3.500 Mark zu erhöhen, weil diese Freibeträge seit 1977 unverändert seien. Außerdem regt der Ausschuss an, dass die Förderung für Schüler ausschließlich den kommunalen Ämtern für Ausbildungsförderung vorbehalten bleibt und die Förderung für Studierende von den Ämtern für Ausbildungsförderung der Hochschulen bzw. der Studentenwerke geleistet wird. Ferner spricht sich der Kulturausschuss dafür aus, die Förderung von Auslandspraktika auf alle berufsqualifizierenden Bildungsgänge auszudehnen, bei denen solche verpflichtender Bestandteil der Ausbildung sind. Zugleich sollte die Mindestdauer der förderungsfähigen Auslandspraktika für Bildungsgänge an Berufsfachschulen von zwölf auf sechs Wochen herabgesetzt werden. Schließlich wird vorgeschlagen, zukünftig auch Bachelor-Studiengänge zu fördern, deren Lehrveranstaltungen im Rahmen der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit einer deutschen und einer ausländischen Ausbildungsstätte aus organisatorischen Gründen ausschließlich von der ausländischen Hochschule angeboten werden, wenn die Ausbildung zumindest zu einem Teil vom wissenschaftlichen Personal der deutschen Hochschule erfolgt.
Der Ausschuss für Frauen und Jugend, der Ausschuss für Familie und Senioren sowie der Finanzausschuss empfehlen dem Bundesrat, gegen den Gesetzentwurf keine Einwendungen zu erheben.
TO-Punkt 26
Entwurf eines Gesetzes zur Reform des Zivilprozesses
- Drucksache 536/00 -
- zu Drucksache 536/00 -
Der Regierungsentwurf hat zum Ziel, die Qualität der Streiterledigung in der Eingangsinstanz der Zivilgerichte zu verbessern. Hierzu soll die richterliche Verfahrensleitung gestärkt werden. Außerdem enthält der Entwurf Regelungsvorschläge, die dazu führen sollen, dass künftig noch mehr Verfahren gütlich beigelegt werden. Im Bereich der Landgerichte soll die Zuständigkeit des originären Einzelrichters der Regelfall werden, so dass eine bundeseinheitliche Einzelrichterquote von 70 Prozent erreicht werden kann. Mit der Stärkung der Eingangsinstanz soll eine Veränderung der Rechtsmittelinstanzen, das heißt Berufung, Revision und Beschwerde, einhergehen. Grundsätzlich soll das Berufungsverfahren in eine Instanz der Fehlerkontrolle und -beseitigung umgestaltet werden. Zu diesem Zweck wird die Möglichkeit der Zurückweisung von Berufungen ohne Erfolgsaussicht durch Beschluss eröffnet. Auch soll das Berufungsgericht grundsätzlich an die Tatsachenfeststellungen der Eingangsinstanz gebunden sein und nur ausnahmsweise eigene, neue Tatsachenfeststellungen treffen. Beschwerden sollen künftig grundsätzlich nur befristet zulässig sein. Sowohl bei Berufungen als auch bei Beschwerden soll in der Regel ein Einzelrichter entscheiden, wenn die angefochtene Entscheidung von einem Einzelrichter erlassen wurde. Oberlandesgerichte sollen künftig auch für Berufungen und Beschwerden gegen amtsgerichtliche Entscheidungen zu-ständig sein. Zukünftig soll grundsätzlich gegenüber allen Berufungsurteilen die Revision zulässig sein. Sie muss allerdings im Berufungsurteil oder auf Grund einer Nichtzulassungsbeschwerde vom Bundesgerichtshof zugelassen werden. Parallel dazu wird im Bereich des Beschwerderechts eine Rechtsbeschwerdemöglichkeit eingeführt. Darüber hinaus enthält der Gesetzentwurf eine Vielzahl von Vorschlägen zur Änderung anderer Gesetze. Hervorzuheben sind hierbei die abweichenden Regelungen im Bereich des Berufungsrechts in der Arbeitsgerichtsbarkeit.
Ausschussempfehlungen 536/1/00:
Der Finanzausschuss will die Bundesregierung auffordern, den Gesetzentwurf in Hinblick auf die zu erwartenden Mehrkosten so zu überarbeiten, dass er dem Gebot der Kostenneutralität entspricht. Der Ausschuss für Arbeit und Sozialpolitik setzt sich für die weitere Mitwirkung der ehrenamtlichen Richterinnen und Richter bei der Verwerfung der Berufung ein. Der federführende Rechtausschuss lehnt den Gesetzentwurf ab. Für den Fall, dass der Gesetzentwurf weiterverfolgt wird, hält er eine ganze Reihe von Änderungen für notwendig. Dazu gehört, dass die Konzentration aller Berufungen und Beschwerden im Bereich des Zivilprozessrechts beim Oberlandesgericht abgelehnt wird. Ein im Gesetzentwurf vorgesehenes vorgeschaltetes formalisiertes Güteverfahren wird ebenfalls abgelehnt. Die Vorschriften über den originären sowie obligatorischen Einzelrichter sollen gestrichen werden. Auch die Absenkung der Berufungssumme auf 600 EURO soll nicht Gesetz werden. Gleiches gilt für den obligatorischen Einsatz von Einzelrichtern in der Berufungsinstanz.
TO-Punkt 50
Verordnung zur Änderung straßenverkehrsrechtlicher Vorschriften (...ÄndVStVR)
- Drucksache 599/00 -
Schwerpunkte des Verordnungsentwurfs sind die Benutzung von Mobil- oder Autotelefonen im Straßenverkehr, die Neuregelung der Tempo 30-Zonen und des Kreisverkehrs. Auto-, aber auch Radfahrern soll künftig die Benutzung eines Handys oder Autotelefons untersagt sein, wenn hierfür das Handy oder der Hörer des Autotelefons aufgenommen bzw. gehalten werden muss. Zur Benutzung zählen dabei sämtliche Bedienfunktionen wie etwa das Anwählen, das Abrufen von Daten im Internet und auch die Versendung von Kurznachrichten. Darüber hinaus soll dem Wunsch der Kommunen nach Reduzierung des bislang hohen Anforderungsniveaus für die Einrichtung von Tempo 30-Zonen Rechnung getragen werden. Ferner wird für den Kreisverkehr ein neues Verkehrszeichen eingeführt und zugleich das Blinken beim Einfahren in den Kreisverkehr verboten. Beibehalten werden soll dagegen die Regelung für das Setzen des Blinkers bei Ausfahrt aus dem Kreisverkehr.
Ausschussempfehlungen 599/1/00 (neu):
Der federführende Verkehrsausschuss und der Ausschuss für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit empfehlen dem Bundesrat, der Verordnung nach Maßgabe von Änderungen zuzustimmen. Vor allem die in der Verordnung vorgesehene Voraussetzung, dass Tempo 30-Zonen nur Straßen ohne Ampeln umfassen dürfen, wird von den beiden Ausschüssen kritisiert. Das Ziel der Novellierung, den Kommunen die Neueinrichtung von Tempo 30-Zonen zu erleichtern, würde verfehlt, wenn vorhandene Tempo 30-Zonen, in denen sich Ampeln zum Schutz des Fußgängerverkehrs befinden, aufgehoben oder mit erheblichem finanziellen Aufwand abgerüstet werden müssten. Der Verkehrsausschuss schlägt deshalb vor, dass nur solche Straßen nicht als Tempo 30-Zonen eingerichtet werden können, in denen sich durch Ampelanlagen geregelte Kreuzungen befinden. Der Umweltausschuss regt darüber hinaus an, vor dem 1. November 2000 angeordnete Tempo 30-Zonen mit Ampeln zum Schutz der Fußgänger weiterhin für zulässig zu erklären. Weitere Änderungsvorschläge betreffen den Schutz der Wohnbevölkerung vor Emissionen des Straßenverkehrs sowie das In-Kraft-Treten der Verordnung. Gegen das geplante Handy-Nutzungsverbot hat der Ausschuss dagegen nichts einzuwenden.
Der Ausschuss für Innere Angelegenheiten und der Rechtsausschuss empfehlen dem Bundesrat, der Verordnung unverändert zuzustimmen.
TO-Punkt 51
Verordnung über die Vergabe öffentlicher Aufträge (Vergabeverordnung-VgV-)
- Drucksache 455/00 -
Die von der Bundesregierung vorgelegte Verordnung dient der Umsetzung der geänderten EU-Bestimmungen in nationales Recht. Ferner soll die Rechtsprechung des EuGH und der nationalen Gerichtsbarkeit in vergaberechtlichen Angelegenheiten im materiellen Vergaberecht bzw. im öffentlichen Auftragswesen Eingang finden. Die Verordnung übernimmt wesentliche Regelungen der bisherigen Vergabeverordnung mit Verweisungen auf die bisherigen Verdingungsordnungen (VOB, VOL und VOF). Eine entscheidende Neuerung ist im Hinblick auf die Informationspflicht des öffentlichen Auftraggebers gegenüber allen Bietern vor Vertragsabschluss über die beabsichtigte Zuschlagserteilung. Die Information soll den Namen des Bieters, dessen Angebot angenommen werden soll, und den Grund für die Ablehnung der anderen Angebote enthalten. Ein Verstoß gegen diese Informationspflicht soll die Nichtigkeit des geschlossenen Vertrages zur Folge haben.
Ausschussempfehlungen 455/1/00:
Der federführende Wirtschaftsausschuss, der Finanzausschuss, der Ausschuss für Innere Angelegenheiten und der Ausschuss für Städtebau, Wohnungswesen und Raumordnung empfehlen dem Bundesrat, der Verordnung nach Maßgabe von verschiedenen Änderungen zuzustimmen. Diese Änderungen betreffen im Wesentlichen eine Präzisierung für Aufträge im Sektorenbereich, die Konkretisierung der neu eingeführten Informationspflicht der Auftraggeber sowie die Definition der vom Vergabeverfahren ausgeschlossenen Personen. Der Ausschuss für Arbeit und Sozialpolitik empfiehlt dem Bundesrat, der Verordnung unverändert zuzustimmen.
Der federführende Wirtschaftsausschuss, der Ausschuss für Innere Angelegenheiten und der Ausschuss für Städtebau, Wohnungswesen und Raumordnung empfehlen dem Bundesrat ferner die Annahme von Entschließungen bezüglich des Verordnungsgebungsverfahrens und zur Neuordnung des Vergaberechts.
TO-Punkt 56 a
Gesetz zur Änderung des Grundgesetzes (Artikel 16)
- Drucksache 670/00 -
Durch die geplante Änderung des Grundgesetzes soll das verfassungsrechtliche Verbot der Auslieferung Deutscher an das Ausland für zwei Fallgruppen gelockert werden: Zum einen soll die Überstellung Deutscher an internationale Gerichtshöfe ermöglicht werden, zum anderen die Auslieferung deutscher Staatsangehöriger an die Mitgliedstaaten der Europäischen Union (EU). Der Bundesrat hatte bereits anlässlich der Beratungen der Gesetze zum Jugoslawien- und zum Ruanda-Strafgerichtshof Mitte der 90er-Jahre angemahnt, die entsprechenden rechtlichen Voraussetzungen für die Überstellung Deutscher an diese Gerichte zu schaffen. Zwar besteht eine völkerrechtliche Verpflichtung Deutschlands zur Überstellung auch eigener Staatsangehöriger. Noch wäre die Bundesrepublik aber aus verfassungsrechtlichen Gründen gehindert, einem solchen Ersuchen nachzukommen. Gemäß der vorgeschlagenen Grundgesetzänderung werden Überstellungen aber nur aufgrund eines Gesetzes erfolgen können. Mit der Auslieferungsmöglichkeit deutscher Staatsangehöriger an einen Mitgliedstaat der EU soll dem angestrebten Ziel der europäischen Integration Rechnung getragen werden. Gegenüber dem Gesetzentwurf sieht die nunmehr vom Deutschen Bundestag beschlossene Fassung der Änderung des Artikel 16 Grundgesetz vor, dass eine Auslieferung Deutscher nur erfolgen darf, wenn sichergestellt ist, dass der Auszuliefernde nach rechtsstaatlichen Grundsätzen behandelt wird.
Der Rechtsausschuss empfiehlt dem Bundesrat, dem Gesetz zuzustimmen.
TO-Punkt 56 b
Gesetz zum Römischen Statut des Internationalen Strafgerichtshofs vom 17. Juli 1998 (IStGH-Statutgesetz)
- Drucksache 671/00 -
Durch das Gesetz sollen die von deutscher Seite erforderlichen Voraussetzungen für das In-Kraft-Treten des Römischen Statuts des Internationalen Strafgerichtshofs (IStGH) geschaffen werden. Die Vorlage beschränkt sich darauf, die Zustimmung zu dem Statut herbeizuführen. Das Statut sieht die Errichtung des IStGH als ständige Einrichtung mit Sitz in den Niederlanden (Den Haag) vor. Seine Zuständigkeit ist auf vier besonders schwere Verbrechen beschränkt, welche die internationale Gemeinschaft als Ganzes berühren: Völkermord, Verbrechen gegen die Menschlichkeit, Kriegsverbrechen sowie Verbrechen der Aggression.
Ausschussempfehlungen 671/1/00:
Der Rechtsausschuss empfiehlt dem Bundesrat, zu dem Gesetz den Vermittlungsausschuss nicht anzurufen, das Gesetz also zu billigen und darüber hinaus eine Entschließung zu fassen. Nach Ansicht des Rechtsausschusses soll der Bundesrat die Bundesregierung bitten, zu dem Übereinkommen eine Erklärung abzugeben, wonach dem Ersuchen um Zusammenarbeit und allen übrigen Unterlagen entsprechende Übersetzungen in deutscher Sprache beigefügt werden müssen, sofern diese nicht ohnehin in Deutsch abgefasst sind. Die Praxis zeige, dass ein Übersetzungsverzicht nicht zu der gewünschten beschleunigten Erledigung beitrage. Außerdem entstünden Bund und Ländern hierdurch Kosten- und Haftungsrisiken.
TO-Punkt 57
Entschließung des Bundesrates zu institutionellen Reformen und der Weiterentwicklung der EU
- Antrag aller Länder -
- Drucksache 680/00 -
Nach dieser von allen Ländern gemeinsam beantragten Entschließung soll der Bundesrat feststellen, dass die Regierungskonferenz in wesentlichen Punkten hinter den selbst gesetzten Erwartungen zurückbleibe. Der Bundesrat soll deshalb die Bundesregierung auffordern, auf einen erfolgreichen Abschluss der Verhandlungen beim Europäischen Rat in Nizza hinzuwirken. Außerdem müsse sich an die laufende Regierungskonferenz eine weitere anschließen, die sich mit den nächsten Schritten einer grundlegenden Reform der EU und dem Zeitplan ihrer Umsetzung befasst. Darüber hinaus benennen die antragstellenden Länder konkret die Fälle, in denen nach ihrer Ansicht zukünftig Entscheidungen mit qualifizierter Mehrheit gefällt werden können und in denen es beim Einstimmigkeitsprinzip bleiben sollte. Darüber hinaus sind sie der Auffassung, dass der Ausschuss der Regionen noch nicht über ausreichende Möglichkeiten verfüge, seine Mitwirkungsrechte effektiv zu wahren und schlagen hierfür Maßnahmen vor. Schließlich erwarten die Länder beim Thema Daseinsvorsorge, dass die Bundesregierung die gemeinsamen Anliegen von Bund und Ländern bei den weiteren Verhandlungen vertritt.
Die Länder haben beantragt, die Vorlage auf die Tagesordnung am 10. November zu setzen und eine sofortige Entscheidung in der Sache herbeizuführen.
TO-Punkt 58
Entschließung des Bundesrates zum geänderten Vorschlag für eine Richtlinie des Rates betr. das Recht auf Familienzusammenführung (Fassung vom Oktober 2000)
- Antrag des Landes Baden-Württemberg -
- Drucksache 681/00 -
Nach der von Baden-Württemberg beantragten Entschließung soll der Bundesrat feststellen, dass die in seiner Stellungnahme vom 9. Juni dieses Jahres genannten Änderungsvorschläge in dem von der Kommission im Oktober 2000 vorgelegten Richtlinienentwurf zur Familienzusammenführung im Wesentlichen nicht berücksichtigt wurden. Zum Beispiel sei der Kreis der nachzugsberechtigten Familienangehörigen nach wie vor zu weit gefasst und der Anspruch auf Familienzusammenführung von Verwandten in aufsteigender Linie zu weitgehend. Außerdem stehe die quantifizierte Prognose der Bundesregierung über die mittelfristigen Wirkungen des Richtlinienvorschlages auf die sozialen Sicherungssysteme, um die der Bundesrat gebeten hatte, noch aus.
Ausschussberatungen haben noch nicht stattgefunden. Baden-Württemberg hat die Behandlung der Entschließung in der Plenarsitzung und sofortige Sachentscheidung beantragt.
TO-Punkt 59
Entschließung des Bundesrates zur Verbesserung der steuerlichen Behandlung von Internet und Personalcomputern
- Antrag der Länder Baden-Württemberg, Hessen -
- Drucksache 604/00 -
Der Antrag der Länder Baden-Württemberg und Hessen zielt darauf ab, dass der Bundesrat sich für die gesetzliche Steuerfreistellung der Vorteile aus der privaten Mitbenutzung von arbeitgebereigenen Telekommunikationseinrichtungen einschließlich betrieblicher Personalcomputer ausspricht. Steuerfrei sollen nicht nur die beim Arbeitgeber aufgestellten PCs, sondern auch die private Mitbenutzung durch den Arbeitnehmer sein, wenn der Arbeitgeber die Telekommunikationsgeräte gegebenenfalls einschließlich Computeranlage dem Arbeitnehmer zur beruflichen Nutzung überlassen hat. In den Jahren 2000 und 2001 soll hierzu ein Freibetrag von 100 Mark und ab 2002 ein solcher von 50 Euro gewährt werden. Darüber hinaus soll sich der Bundesrat dafür aussprechen, dass bei typischen Tätigkeiten ein bestimmter beruflicher Anteil der Anschaffungskosten eines privat angeschafften PCs steuermindernd berücksichtigt werden darf.
Ausschussempfehlungen 604/1/00:
Während im federführenden Finanzausschuss eine Empfehlung an den Bundesrat nicht zu Stande gekommen ist, empfiehlt der Wirtschaftsausschuss dem Bundesrat, die Entschließung anzunehmen. Der Ausschuss für Arbeit und Sozialpolitik hat seine Beratungen noch nicht abgeschlossen. Die antragstellenden Länder haben jedoch beantragt, die Vorlage bereits jetzt auf die Tagesordnung zu setzen.
47.220 Zeichen