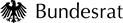BundesratKOMPAKT - Das Wichtigste zur Sitzung
Bundesrat macht Weg frei für Sondervermögen und Lockerung der Schuldenbremse
Bundesrat macht Weg frei für Sondervermögen und Lockerung der Schuldenbremse
35 Tagesordnungspunkte behandelte der Bundesrat in seiner März-Sitzung. Breiten Raum nahm dabei die Debatte zu den Grundgesetzänderungen ein.
Allein acht Regierungschefinnen bzw. -chefs ergriffen zur Lockerung der Schuldenbremse und zur Errichtung eines Sondervermögens das Wort. Mit 53 Stimmen erlangte das vom Bundestag vor wenigen Tagen beschlossene Gesetz deutlich die notwendige Zwei-Drittel-Mehrheit unter den Ländern.
Gesetze aus dem Bundestag
Daneben gab der Bundesrat grünes Licht für fünf weitere Gesetze aus dem Bundestag, darunter die Erhöhung der Vergütung für Vormünder und Betreuer und Anpassungen bei Rechtsanwalts- und Justizkosten, die Einführung eines oder einer Bundesbeauftragten gegen den sexuellen Missbrauch von Kindern und Jugendlichen sowie Änderungen im Schornsteinfegerrecht.
Initiativen der Länder
Auch wenn die neue Bundesregierung noch nicht im Amt ist, beschloss der Bundesrat zahlreiche an sie gerichtete Forderungen: So setzen sich die Länder für eine finanzielle Absicherung der deutschen Häfen durch den Bund ein, fordern einen besseren Datenaustausch zwischen Polizei und anderen Behörden sowie höhere Strafen beim Einsatz von K.o.-Tropfen bei Sexual- und Raubstraftaten. Der Bundesrat ruft die Bundesregierung außerdem zu Maßnahmen zur gleichberechtigten Terminvergabe in Arztpraxen sowie gegen die kürzlich eingeführten US-Strafzölle auf.
Vorgestellt und in die Ausschüsse verwiesen wurden Entschließungen mit der Forderung, die Potenziale der Industrie für eine bessere Verteidigungsfähigkeit zu nutzen, sowie zur Ausweitung des Jagdrechts auf den Wolf.
Europa und nationale Verordnungen
Stellung nahmen die Länder zum geplanten Kompass der Kommission für eine wettbewerbsfähige EU. Sie stimmten auch acht nationalen Verordnungen zu, etwa zur Verwaltung des Transformationsfonds im Krankenhausbereich (der nächste Schritt der Krankenhausreform) und zur Steuerberatervergütung.
Gedenken
Noch bevor die Bundesratsmitglieder ihre Beratungen begannen, gedachten sie mit Schweigeminuten dem zweimaligen Bundesratspräsidenten Bernhard Vogel, der am 2. März 2025 gestorben ist, sowie dem ehemaligen Justizminister des Landes Rheinland-Pfalz Herbert Mertin, verstorben am 21. Februar 2025.
Alle Videos in der Mediathek
Die Videos der Redebeiträge der Plenarsitzung stehen in BundesratKOMPAKT, in der App und in der Mediathek zum Ansehen, Teilen und Download bereit.