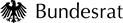BundesratKOMPAKT - Das Wichtigste zur Sitzung
Verlängerung der Mietpreisbremse, Mutterschutz bei Fehlgeburten und hausärztliche Versorgung
Verlängerung der Mietpreisbremse, Mutterschutz bei Fehlgeburten und hausärztliche Versorgung
In seiner ersten Plenarsitzung im neuen Jahr behandelt der Bundesrat eine umfangreiche Themenpalette mit über 50 Punkten, darunter 16 Gesetze aus dem Bundestag.
Gesetze aus dem Bundestag
Final entscheiden die Länder über Gesetze, die der Bundestag in den letzten Wochen nach dem Ende der Ampel-Koalition beschlossen hat: Ein Thema ist die Anpassung des Mutterschutzgesetzes, das künftig auch nach einer Fehlgeburt Mutterschutzfristen vorsieht. Mit dem Gesundheitsversorgungsstärkungsgesetz sollen Patientinnen und Patienten schneller einen Termin beim Hausarzt bekommen. Weitere Themen sind die Zeitenwende bei der Bundeswehr, die Rehabilitierung von Opfern politischer Verfolgung in der DDR und die Sozialversicherungspflicht von Honorarlehrkräften. Außerdem steht ein umfassendes Wirtschaftspaket (TOP 12, 13, 14, 15, 16) auf der Tagesordnung, das unter anderem Biogasanlagen erheblich fördert.
Eigene Initiativen der Länder
Anlässlich des dritten Jahrestages des völkerrechtswidrigen Angriffs Russlands auf die Ukraine befassen sich die Länder mit einer Entschließung, in der das Vorgehen Russlands scharf verurteilt und die Notwendigkeit weiterer Maßnahmen der EU zur Unterstützung der Ukraine betont wird.
Zu den weiteren Initiativen aus den eigenen Reihen gehören in dieser Runde ein Gesetzentwurf für einen besseren Schutz vor sexueller Belästigung durch obszöne Gesten und Beleidigungen sowie ein Gesetzentwurf zur Verlängerung der Mietpreisbremse. Zum Wohnungsmietrecht liegt auch ein Gesetzentwurf der Bundesregierung vor, zu dem die Länder Stellung nehmen können (TOP 19b). Weiterhin entscheidet der Bundesrat über Entschließungen zur Schadensfinanzierung bei Starkregen und Extremwetterereignissen sowie zu weniger Bürokratie bei der Umsetzung von EU-Vorgaben.
Erstmals vorgestellt werden unter anderem Entschließungen zu schärferen Regeln bei Asyl und Migration (TOP 26, 27), für eine neue Luftverkehrspolitik (TOP 31) und zu Strafen beim Einsatz von KO-Tropfen (TOP 28).
Vorhaben der Bundesregierung
Kurz vor dem Ende der Legislaturperiode hat die Bundesregierung dem Bundesrat eine Reihe von Gesetzentwürfen zur Stellungnahme vorgelegt. Dabei geht es zum Beispiel um die Stärkung der Pflegekompetenz (TOP 33) mit erweiterten Befugnissen für Pflegefachkräfte sowie um Verbesserungen der Suizidprävention (TOP 34).
Europarecht und deutsche Verordnungen
Auch europarechtliche Themen stehen auf der Tagesordnung, darunter die Zusammenarbeit bei der Besteuerung multinationaler Unternehmen (TOP 37), die Umsetzung des Europäischen Forschungsraums (TOP 38) sowie eine Verordnung zur Stärkung der Landwirtschaft (TOP 39).
Darüber hinaus beschäftigen sich die Länder mit verschiedenen Verordnungen der Bundesregierung, etwa zu Berufskrankheiten (TOP 40), zur Arzneimittelverschreibung (TOP 45) und zur Betäubungsmittelverschreibung (TOP 43).
Ergänzungen möglich
Die Tagesordnung kann bis zum Sitzungsbeginn noch ergänzt werden.
Livestream - Mediathek - Social Media
Ab 9:30 Uhr wird die Plenarsitzung auf www.bundesrat.de und in der App des Bundesrates live übertragen. Bereits während des Vormittags stehen Videos und einzelne Redebeiträge in BundesratKOMPAKT und in der Mediathek zum Download bereit. Über den Sitzungsverlauf informieren wir Sie auch über den Kurznachrichtendienst X.