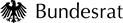BundesratKOMPAKT - Das Wichtigste zur Sitzung
Bundesverfassungsgericht, Steueranpassungen und Deutschlandticket
Bundesverfassungsgericht, Steueranpassungen und Deutschlandticket
60 Punkte standen auf der Tagesordnung der letzten Bundesratssitzung im Jahr 2024. Neun Gesetze, darunter eine Verfassungsänderung, hatte der Bundestag erst kurz zuvor beschlossen.
Zu Beginn des Plenums hielt Bundesratspräsidentin Anke Rehlinger eine Gedenkrede für die Opfer unter den Sinti, Roma und Jenischen im Nationalsozialismus; anschließend erhob sich das Plenum für eine Schweigeminute.
Grünes Licht für Bundestagsbeschlüsse
Danach stimmten die Länder einer Änderung des Grundgesetzes zu, die das Bundesverfassungsgericht stärker vor politischer Einflussnahme schützt. Der Bundesrat stimmte auch dem Steuerfortentwicklungsgesetz, das dem Abgleich der kalten Progression dient und unter anderem eine Erhöhung des Kindergeldes vorsieht, sowie Änderungen am Regionalisierungsgesetz zu. Letztere sichern die Finanzierung des Deutschlandtickets. Auch Anpassungen am Energiewirtschaftsgesetz zur Gasspeicherpauschale, zum Abgeordnetengesetz mit Regelungen zur Öffentlichkeitsarbeit der Fraktionen sowie das Filmförderungsgesetz passierten den Bundesrat.
Eigene Gesetzentwürfe und Entschließungen
Die Länder beschlossen, einen Gesetzentwurf zur frühzeitigen Integration von Asylbewerbern in den Arbeitsmarkt beim Deutschen Bundestag einzubringen. Ein weiterer eigener Entwurf zur Verlängerung der Mietpreisbremse wurde vorgestellt und wird voraussichtlich in einem zukünftigen Plenum zur Abstimmung gebracht. Der Bundesrat fasste zudem Entschließungen an die Adresse der Bundesregierung, unter anderem zur Unterstützung der Automobilindustrie und zum verbesserten Schutz vor häuslicher Gewalt durch elektronische Aufenthaltsüberwachungen (Fußfesseln). Vorgestellt und in die Ausschüsse überwiesen wurden Entschließungsanträge zur Überfüllung von EU-Anforderungen (sog. „Gold-Plating“), zur verbraucherfreundlichen Preisgestaltung von Ladestrom, zur Schuldenbremse sowie zur Modernisierung und nachhaltigen Entwicklung der deutschen Häfen.
Stimmungsbild zu Plänen der Bundesregierung
Kurz vor Ende der Legislaturperiode des Bundestages hatte der Bundesrat noch die Gelegenheit, zu zahlreichen Gesetzentwürfen der Bundesregierung Stellung zu nehmen. Diese Chance ergriff er beispielsweise bei der geplanten Reform des Vergaberechts sowie dem Tariftreuegesetz, das darauf zielt, öffentliche Aufträge des Bundes nur noch an Unternehmen zu vergeben, die nach Tarif zahlen. Die Länder äußerten sich auch zu den Regierungsplänen für ein verlässliches Hilfssystem bei geschlechtsspezifischer und häuslicher Gewalt, zur Ausgestaltung der inklusiven Kinder- und Jugendhilfe sowie zur Reform der Entschädigung für Strafverfolgungsmaßnahmen mit höheren Entschädigungsansprüchen bei fehlerhaften Inhaftierungen.
Verordnungen der EU und der Bundesregierung
Die Länder nahmen auch zu zwei Verordnungsvorschlägen aus Brüssel Stellung: zu europäischen Bevölkerungs- und Wohnungsstatistiken und zur Regionalen Soforthilfe für den Wiederaufbau. Zudem passierten zehn Verordnungen der Bundesregierung den Bundesrat. So stimmten die Länder der Anpassung des Beitrags zur sozialen Pflegeversicherung zu. Auch eine Verordnung, die die Verwaltung zur Einwilligungen in Cookies vereinfachen soll, fand die Zustimmung des Bundesrates. Gleiches gilt für die Verordnung zur Bereinigung der Namensschreibweise im Meldewesen sowie für die Verordnung zur Neuordnung des Ladesäulenrechts. Auch die Verwaltungsvorschrift zur Straßenverkehrsordnung, die die Zulassung von Schwertransporten betrifft, wurde von den Ländern abgesegnet.
Alle Videos in der Mediathek
Die Videos der Redebeiträge und ein Gesamtmitschnitt der Plenarsitzung stehen in BundesratKOMPAKT, in der App und in der Mediathek zum Ansehen, Teilen und Download bereit.