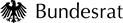BundesratKOMPAKT - Das Wichtigste zur Sitzung
Grünes Licht für Krankenhausreform, Jahressteuergesetz 2024 und Bürokratieentlastung
Grünes Licht für Krankenhausreform, Jahressteuergesetz 2024 und Bürokratieentlastung
Neben der Antrittsrede von Bundesratspräsidentin Anke Rehlinger standen die Krankenhausreform und das Jahressteuergesetz 2024 im Mittelpunkt des Novemberplenums.
Bundesratspräsidentin Anke Rehlinger ist seit 1. November 2024 im Amt und beschwor in ihrer Antrittsrede den Zusammenhalt der Länder und warb für eine enge Zusammenarbeit in Europa.
Gesetze aus dem Bundestag
In einer kontroversen Debatte mit über einem Dutzend Reden berieten die Länder über ihre Haltung zur vom Bundestag verabschiedeten Krankenhausreform. Ein Antrag, das Krankenhausversorgungsverbesserungsgesetz in den Vermittlungsausschuss zu überweisen, fand am Ende keine Mehrheit - der Bundesrat hat das Gesetz somit gebilligt. Zudem stimmte er dem Jahressteuergesetz 2024 und der steuerlichen Freistellung des Existenzminimums 2024 zu. Auch die Umsetzung von EU-Regeln zur Tiergesundheit mit höheren Bußgeldern für Tierschutzvergehen fand die Billigung der Länder.
Vorstellung von Länderinitiativen
Einige Länder stellten Initiativen vor, mit denen sich nun die Fachausschüsse beschäftigen. Dazu gehören ein Gesetz, das sexuelle Belästigung durch verbale Äußerungen und Gesten unter Strafe stellt und zwei Entschließungen, die sich mit der aktuellen und zukünftigen Beteiligung des Bundes an durch Hochwasser und Extremwetter verursachten Schäden befassen. Auch ein Vorstoß zur Reform der Schuldenbremse wurde vorgestellt.
Der Bundesrat fasste eine Entschließung für höhere Strafen bei fahrlässigen wie auch vorsätzlichen Beschädigungen von Telekommunikationsanlagen. Keine Mehrheit fanden Initiativen zu höheren Strafen bei Angriffen auf Rettungskräfte und zur Mobilisierung von Wohnraum.
Zahlreiche Stellungnahmen
Im sogenannten ersten Durchgang nahm der Bundesrat 21 Gesetze der Bundesregierung unter die Lupe und formulierte Ergänzungs- bzw. Änderungsvorschläge, etwa zur sogenannten Nutzhanfliberalisierung, zum Sprengstoffgesetz mit härteren Strafen für das Aufsprengen von Geldautomaten, zum Elektro- und Elektronikgerätegesetz sowie zum Gesetz zur Anpassung des nationalen Rechts an die Reform des Gemeinsamen Europäischen Asylsystems (GEAS-Anpassungsgesetz).
Auch zu Vorlagen aus Brüssel äußerte sich der Bundesrat und verabschiedete unter anderem eine ausführliche Stellungnahme zu den Plänen für mehr rauchfreie Zonen im Freien.
Verordnungen der Bundesregierung
Der Bundesrat stimmte zudem zahlreichen Rechtsverordnungen der Bundesregierung zu, zum Beispiel zur Bürokratieentlastung, zum Transport von Gasflaschen und anderen Gefahrengütern sowie zum Aufenthalt von Flüchtlingen aus der Ukraine (TOP 41 und TOP 42).
Alle Videos in der Mediathek
Die Videos der Redebeiträge und ein Gesamtmitschnitt der Plenarsitzung stehen in BundesratKOMPAKT, in der App und in der Mediathek zum Ansehen, Teilen und Download bereit.